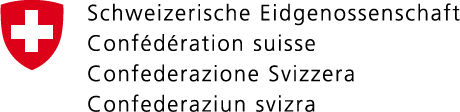Signore e signori membri delle Camere federali,
Eccellenze,
Gentili signore e signori,
Vielen Dank für die Einladung – eine wertvolle Gelegenheit, mit Ihnen einige Gedanken zu teilen.
Seit ich vor einigen Monaten die Anfrage von Ständerat Jositsch erhalten habe, bei der parlamentarsichen Gruppe Schweiz – Vereinte Nationen eine Bilanz zum Einsitz der Schweiz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu ziehen, hat sich die Welt rasant verändert. «Weltfrieden – Quo vadis?» bedeutet für uns unweigerlich auch «Schweiz – Quo vadis?»
Um die Geschwindigkeit dieses Wandels vor Augen zu führen, lohnt sich ein Blick zurück – nur drei Jahre.
- Noch vor drei Jahren galt Krieg in Europa als nahezu unvorstellbar. Heute ist er bittere Realität, hat Millionen zur Flucht gezwungen und unsere sicherheitspolitischen Gewissheiten erschüttert.
- Die NATO wurde als «hirntot» bezeichnet, dann zum Symbol transatlantischer Einigkeit – und ringt heute mit ihrem inneren Zusammenhalt und ihrer Glaubwürdigkeit.
- Deutschland und Frankreich, einst Europas Stabilitätsanker, kämpfen heute mit wirtschaftlichen Krisen und innerer Spaltung. Gleichzeitig gewinnen frühere Sorgenkinder wie Italien, Spanien und Griechenland an wirtschaftlicher Stärke. Die Stabilität verlagert sich allmählich von Nord- nach Südeuropa – noch vor zehn Jahren undenkbar.
Die Zeitenwende ist Realität. Über Jahrzehnte gültige Dogmen lösen sich auf, und die Welt verändert sich schneller, als wir es uns vorstellen konnten. Wir befinden uns mitten in einer Phase der globalen Disruption – in einer Übergangszeit zu einer neuen Ära.
In solchen Zeiten braucht es analytische Distanz, um die Entwicklungen richtig einzuordnen. Was beobachten wir ?
1. Machtpolitik kehrt zurück – und ändert die Spielregeln
Wir müssen feststellen: Die Grossmachtpolitik ist zurück. Grossmächte setzen ihre Interessen zunehmend kompromisslos durch, Machtpolitik ersetzt die regelbasierte Ordnung. Gleichzeitig werden Konflikte nicht mehr direkt zwischen den Grossmächten ausgetragen, sondern durch Stellvertreter und wirtschaftliche Abhängigkeiten instrumentalisiert.
Viele Länder sind auf dieses neue Spiel nicht vorbereitet. Alte Gewissheiten schwinden, Freunde werden unberechenbar, Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit mehr.
Besonders Europa spürt den Wandel: Frieden und Stabilität galten lange als gegeben, doch nun ist klar, dass mehr Unabhängigkeit nötig ist – wirtschaftlich wie sicherheitspolitisch. Doch noch fehlt vielerorts der Wille, wirtschaftliche Stärke in echte Sicherheitskapazitäten zu übersetzen.
2. Und die Schweiz? Zuschauer oder Akteur?
Manchmal klingt in der Schweiz eine gewisse Schadenfreude über diese Entwicklungen durch. Doch das wäre fehl am Platz – wir sitzen im selben Boot. Geopolitik ist kein Spektakel, das wir aus sicherer Distanz beobachten. Wir sind nicht nur Zuschauer, sondern mittendrin.
Ein Regierungschef stellte einmal in einer Diskussion über Kernwaffen eine unerwartete Frage: «Was tun wir, wenn der Weltuntergang kommt?» Alle warteten gespannt auf die Antwort. Dann sagte er: «Wir gehen in die Schweiz!». Verblüfft schaute ich ihn an, als er mich fragte: «Wissen Sie, warum, Herr Kollege?» Während ich noch nach einer Antwort suchte, schmunzelte er und sagte: «Weil in der Schweiz selbst der Weltuntergang zehn Jahre später kommt.»
In diesem Witz steckt mehr Wahrheit, als man zunächst denkt. Unsere Stabilität und Langsamkeit bewahren uns vor manchen Fehlern, doch wir sind den globalen Trends genauso ausgesetzt wie alle anderen.
Die Schweiz ist als eines der globalisiertesten Länder der Welt darauf angewiesen, dass Regeln zählen – denn wir haben keine Macht, sie zu erzwingen. Deshalb müssen wir unsere Vernetzung gezielt stärken, etwa mit den USA. Doch wir dürfen uns keine Illusionen machen: Wenn Verträge keinen Nutzen mehr bringen, setzen gerade die Grossmächte rücksichtslos ihre Interessen durch.
Gerade deshalb braucht die Schweiz – mitten in Europa, geografisch, wirtschaftlich und sicherheitspolitisch – eine EU, die auf Regeln setzt, trotz aller Schwächen. Die Bilateralen stabil und zukunftsfähig zu verankern, ist nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern eine strategische Notwendigkeit. Ein altes arabisches Sprichwort sagt: „Wer in Frieden mit seinem Nachbarn lebt, schläft ohne Angst.“ Das gilt nicht nur für Beziehungen zwischen Menschen, sondern auch zwischen Staaten.
3. Die Schweiz im Sicherheitsrat: Eine positive Bilanz
Unser Einsatz für die regelbasierte Ordnung geht aber über die EU hinaus. Unsere Neutralität begrenzt zwar unsere Rolle in der «Hard Security» Europas, doch im Bereich der «Soft Security» leisten wir viel. Nächstes Jahr übernehmen wir das Präsidium der OSZE. Und – das ist das eigentliche Thema von heute – wir haben uns in den letzten zwei Jahren aktiv im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingebracht.
Hätten wir gewusst, was auf die Welt zukommt, bin ich mir nicht sicher, ob die Schweiz den Mut gehabt hätte, für den Sicherheitsrat zu kandidieren. Schon so war die innenpolitische Debatte intensiv: Während die einen das Ende unserer Neutralität beschworen, sahen uns andere am Tisch der Macht – in der «Champions League» der Diplomatie.
Deshalb haben wir uns minutiös vorbereitet. Wir haben klare Prozesse zwischen Verwaltung, Bundesrat und Parlament definiert. Das ermöglichte uns, sachlich und ruhig zu arbeiten. Ich selbst war in dieser Zeit rund zwanzig Mal in New York.
Die geopolitischen Herausforderungen der letzten zwei Jahre haben den Sicherheitsrat oft blockiert. In politisch wenig umstrittenen Kontexten funktioniert er noch – doch bei zentralen Krisen kommt es immer häufiger zu Vetos und Blockaden. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen konnte die Schweiz wichtige Akzente setzen, wie:
• Die Förderung der nuklearen Sicherheit, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kernkraftwerk Saporischschja.
• Die Verabschiedung der von uns initiierten Resolution zum Schutz humanitärer Helfer in Konfliktgebieten.
• Die Einbringung der Science Diplomacy in die Agenda des Sicherheitsrats.
Rückblickend können wir mit Stolz – aber auch mit Demut – sagen: Die Schweiz kann Sicherheitsrat. Wir haben ruhig, kompetent und glaubwürdig agiert. Wir haben weder über- noch unterschätzt, sondern unsere Rolle präzise ausgefüllt.
Letzte Woche wurde der Bundesrat über den Abschlussbericht zu unserem Einsitz informiert – eine umfassende Dokumentation, die ich Ihnen zur Lektüre empfehle.
4. Schlusswort: Standhaftigkeit statt Lautstärke
Zum Abschluss mein aufrichtiger Dank an alle Mitarbeitenden – besonders an das Team in New York –, die mit unermüdlichem Einsatz oft bis spät in die Nacht gearbeitet haben, damit die Schweiz diese herausfordernden zwei Jahre im Sicherheitsrat erfolgreich meistern konnte.
Auch nach diesem Mandat wird sich die Schweiz in einem anspruchsvollen geopolitischen Umfeld behaupten müssen. Unsere Antwort ist kein hektischer Aktionismus, sondern strategische Geduld – Standhaftigkeit, Qualität und Substanz statt Lautstärke.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.