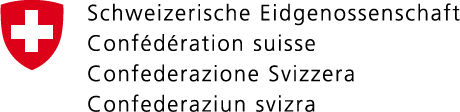La plupart des anniversaires nous invitent à la légèreté et incitent à l’humeur festive. Certains anniversaires, au-delà de la célébration, de la gratitude et de la reconnaissance imposent un temps de réflexion. C'est le cas de celui que nous fêtons aujourd'hui, qui marque 30 ans d’un engagement continu contre le racisme, dans un monde en évolution. Tandis qu’évolution ne rime pas avec progrès.
Comme le montre les chiffres les plus récents, le constat est alarmant: en 2024, 17% de la population résidante suisse a déclaré avoir été victime de discrimination raciale au cours des cinq dernières années. Ce sont 1,2 million de personnes, soit une personne sur six. Sur la même période, plus de 1200 cas de discrimination raciale ont été recensés, une hausse de presque 40%! Et c'est précisément ce contexte si particulier, marqué par l’incertitude et l’incompréhension, par les conflits qui déversent leurs lots de souffrance et qui nous bouleversent, qui prouve combien les travaux de la Commission fédérale contre le racisme sontt nécessaires et indispensables. Hier, aujourd'hui et demain.
Permettez-moi un bref rappel historique. En 1994, la Suisse ratifie la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Une année plus tard, en 1995, est créée la Commission fédérale contre le racisme, à la suite de l’introduction de l’article 261bis du Code pénal, qui sanctionne les actes de haine raciale et l’incitation à la discrimination. Cette double avancée – engagement international et norme pénale nationale – marque le début de la construction institutionnelle suisse contre le racisme.
En 30 ans, la Commission fédérale contre le racisme s’est imposée comme une instance indépendante, experte et proactive, enrichissant autant le débat public, la recherche scientifique, que les politiques publiques. Trois exemples marquants illustrent cette action. En 1996, la commission critique le modèle « des trois cercles » à l’égard des étrangers, permettant l’ouverture d’un débat national sur les fondements discriminatoires de certaines politiques migratoires. Depuis 2008, la commission recense, documente et analyse les incidents racistes, ainsi que le contexte professionnel, scolaire ou public dans lesquels ils sont constatés. Une approche qualitative et quantitative indispensable pour mieux cerner les réalités vécues par les personnes concernées, et trouver des pistes pour agir contre toute forme de discrimination. Plus récemment, en 2023, elle effectue un travail d’analyse sur le racisme et la représentation de la diversité sociale dans les manuels scolaires et propose des recommandations en faveur d’une école inclusive.
Et pour marquer ses 30 années d’existence, la commission a présenté cet après-midi un manifeste en faveur de l’adoption d’une loi générale sur l’égalité de traitement en Suisse. Des démarches concrètes, parmi tant d’autres – qui démontrent comment la Commission fédérale contre le racisme renforce de manière tangible la cohésion nationale – cette précieuse cohésion, moteur du vivre-ensemble, dont on aime tant se faire l’écho.
Der Fachstelle für Rassismusbekämpfung ergänzt die Arbeit der EKR, ohne deren Unabhängigkeit und kritische Rolle infrage zu stellen. Die Gründung der FRB im Jahre 2001 war Ausdruck des politischen Willens, konkreter zu handeln – und des Bewusstseins, wie breit das Spektrum rassistischer Diskriminierung ist: Von anti-Schwarzem-Rassismus über anti-muslimischen Rassismus bis zu Antisemitismus und Rassismus gegen Jenische, Sinti oder Roma. Jede Form von Rassismus hat ihre eigenen historischen, kulturellen und sozialen Besonderheiten; deshalb braucht es gezielte Antworten – bei gleichzeitiger Beibehaltung eines umfassenden Ansatzes. Rassismus zu bekämpfen bedeutet, den sozialen Zusammenhalt, die Grundrechte und die Würde aller Menschen zu schützen.
Rassismus verändert sich: Er versteckt sich neuerdings in vermeintlich harmlosen Begriffen wie Remigration. Er ist unsichtbar eingeschrieben in die Algorithmen, die bestimmen, welche Medien wir konsumieren. Und er zeigt sich in oft wortloser Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt und in der Bildung. Die Formen von Rassismus verändern sich, die Substanz nicht. Das gilt auch für die Hassrede im Netz, die sich oft mit Desinformationen und Verschwörungstheorien mit rassistischen Untertönen mischt. Hier hat sich – leider – ein weiteres Tätigkeitsfeld geöffnet, in dem die EKR unverzichtbar ist.
Gerade in angespannten Zeiten, also in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer Krisen, werden nach wie vor Sündenböcke gesucht – und dass es dabei typischerweise Minderheiten trifft, gehört zu den verheerendsten Konstanten der Geschichte. Einer Geschichte, die nicht zuende geht - und die uns darum verpflichtet, in unserem Engagement gegen Rassismus und Anti-Semitismus nie nachzulassen. Die EKR fungiert seit 30 Jahren als Stimme der Vernunft und des Rechtsstaates: Sie erinnert daran, dass die Gleichwertigkeit und die Gleichberechtigung aller Menschen kein Luxus ist, sondern Grundlage unserer Demokratie.
Le Conseil fédéral a été chargé par le Parlement d’élaborer une première stratégie nationale contre le racisme et l’antisémitisme, ainsi qu’un plan d’action. Cette stratégie est indispensable, car le racisme provoque des souffrances. Personne ne peut l’ignorer ou le réfuter. Il est documenté par les données, les monitorings, les témoignages et dans l’actualité quotidienne. Nous vivons une époque marquée par une polarisation inquiétante du débat public. Il est essentiel d’envoyer un signal fort d’unité, de solidarité et de respect inconditionnel des droits fondamentaux. Apporter une compréhenion partagée des enjeux liés au racisme et à l’antisémitisme, c’est renforcer l’engagement commun des autorités, de la société civile, des institutions et de toutes les personnes concernées par cette situation.
Die Kultur des gegenseitigen Respekts und der Meinungsäusserungsfreiheit; eine Kultur, die wir aufgebaut haben und auf die wir in der Schweiz so stolz sind: Diese Kultur ist ein «work-in-progress». Und sie wird ein «work-in-progress» bleiben, auch und gerade dann, wenn der Fortschritt mühsamer wird, auch und gerade dann, wenn sogar Rückschritte drohen. So wie heute, wo zahlreiche globale Konflikte – transportiert und potenziert durch die «social media» sich auch hierzulande in Gehässigkeiten und Aggressionen manifestieren. Der gegenwärtige massive Anstieg von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus ist auch eine Reaktion auf die dramatische Situation im Nahen Osten. Zum Engagement gegen Rassismus und Anti-Semitismus im Inland gehört untrennbar eine Haltung, die sich nicht scheut, auch deren Ursachen klar zu benennen.
Die Ursachen klar benennen: Der Bundesrat hat das getan nach dem brutalen, terroristischen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Er hat das Verbot der Hamas unterstützt und fordert bis heute eine sofortige Freilassung der Geiseln. Die Ursachen klar benennen: Der Bundesrat tut das heute, da sich in Gaza eine humanitäre Tragödie von unvorstellbarem Ausmass ereignet. Gemäss UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist die gesamte Bevölkerung Gazas von einer Hungersnot bedroht. Hunderttausende Zivilistinnen und Zivilisten leiden, weil Israel die Lieferung von humanitärer Hilfe stark einschränkt oder blockiert, was einen krassen Verstoss gegen das Völkerrecht und die Genfer Konvention darstellt.
Le Conseil fédéral réaffirme ses exigences, soit un accès immédiat et inconditionnel de l’aide humanitaire, conformément aux principes du droit international humanitaire; la protection de la population civile; la libération des otages et un cessez-le-feu immédiat; et le respect du droit international.
Wir dürfen unsere Augen nicht davon abwenden, was sich im Nahen Osten ereignet. Und wir dürfen nicht die Illusion unterhalten, das, was dort geschieht, habe nichts mit uns zu tun. Denn solange sich die Situation in Gaza nicht entschärft, werden auch die Spannungen bei uns nicht abnehmen.
Die EKR navigiert seit ihrer Gründung erfolgreich zwischen zwei Narrativen: Jenem der unerschütterlichen Selbstzufriedenheit und jenem der permanenten Selbstanklage. Kein Land wird seinem Selbstbild ganz gerecht. Es gibt einen Graben zwischen Rhetorik und Realität. Es ist das grosse Verdienst der EKR, dass sie uns diesen Graben regelmässig in Erinnerung ruft. Und dass sie uns zugleich Möglichkeiten aufzeigt, dem Ideal einer gerechten Gesellschaft näher zu kommen. Dafür steht die EKR – und das ist ihr Beitrag zu einer starken Schweiz. Also zu einer Schweiz, die gleichzeitig selbstbewusst und selbstkritisch ist.
In diesem Sinne möchte ich dem ersten Präsidenten der ERK, Georg Kreis der zweiten Präsidentin, Martine Brunschwig Graf, Chère Martine, danken. Beide haben eine klare Haltung vertreten, hartnäckig, konsequent, unbeirrbar. So haben sie Vertrauen geschaffen in Zeiten, in denen das Misstrauen wuchs. So haben sie die EKR als unabhängige Stimme gestärk in Zeiten, in denen Unabhängigkeit – oder genauer politische Unbestechlichkeit – als Provokation galt. Ich danke allen früheren und aktuellen Mitgliedern der Kommission, ihrer Präsidentin Ursula Schneider-Schüttel und natürlich den früheren und aktuellen Leiterinnen Doris Angst, Giulia Brogini und Alma Wiecken sowie allen Mitarbeitenden im Sekretariat der EKR. Mein Dank geht auch an Michele Galizia, den ehemaligen Leiter der Fachstelle für Rassismusbekämpfung und die heutige Leiterin, Marianne Helfer.