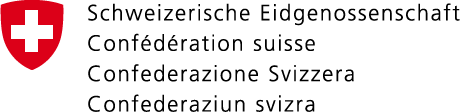Bereits im Dezember 2024 hatte der Bundesrat die Struktur der Genehmigungsvorlage festgelegt: eine Struktur mit einem Stabilisierungs- und einem Weiterentwicklungsteil. Heute hat er diesen Entscheid bestätigt und wird dem Parlament vier separate, referendumsfähige Bundesbeschlüsse vorlegen: einen für die Stabilisierung der bilateralen Beziehungen und drei für die Weiterentwicklung in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Strom und Gesundheit. Dieses Vorgehen respektiert den verfassungsmässigen Grundsatz der Einheit der Materie.
Über die Frage der Unterstellung der neuen Abkommen mit der EU unter ein Referendum hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 26. Juni 2024 erstmals beraten. Er beschloss damals, den Entscheid erst nach Abschluss der Verhandlungen und im Rahmen der Botschaft an das Parlament zu fällen. Nach sorgfältiger Analyse der Verhandlungsergebnisse, eingehender Prüfung früherer Entscheide in vergleichbaren Fällen sowie unter Einbezug der Rechtslehre und der Gespräche mit den Kantonen und den aussenpolitischen Kommissionen ist der Bundesrat zum Schluss gelangt, dass das fakultative Referendum verfassungsrechtlich die am besten abgestützte und politisch tragfähigste Lösung darstellt.
Politische Kontinuität und Kohärenz
Diese Vorgehensweise entspricht der bisherigen Praxis bei den Bilateralen I und II, obwohl insbesondere das Schengen/Dublin-Abkommen eine weitergehende dynamische Rechtsübernahme als die heutigen Paketabkommen vorsah. Trotzdem gelangte der Bundesrat schon damals zum Schluss, dass die neuen Abkommen «zu keiner tiefgreifenden Änderung unseres Staatswesens führen und mithin auch nicht die verfassungsmässige Ordnung tangieren» (BBl 2004 5965, 6288). Mit der Wahl des fakultativen Referendums wahrt der Bundesrat die Kohärenz mit seiner bisherigen Praxis und die Kontinuität der Schweizer Europapolitik.
Diese Option trägt zudem der Ablehnung der Volksinitiative «Staatsverträge vors Volk» durch die Bevölkerung im Jahr 2012 Rechnung, bei der 75,3 Prozent ein obligatorisches Referendum für völkerrechtliche Verträge mit wichtigen rechtssetzenden Bestimmungen abgelehnt haben.
Handlungsspielraum für Parlament und Kantone
Die vom Bundesrat gewählte Option ermöglicht die formelle Verknüpfung der Abkommen mit deren innerstaatlicher Umsetzung. Insbesondere im Hinblick auf zentrale innenpolitische Massnahmen in den Bereichen Lohnschutz und Zuwanderung stellt sie aus demokratiepolitischer Sicht die überzeugendere Lösung dar.
Die grundsätzliche Frage eines obligatorischen Staatsvertragsreferendums sui generis bleibt durch den Entscheid des Bundesrates unberührt. Der heutige Entscheid sichert den grösstmöglichen Handlungsspielraum für Parlament und Kantone. Die Bundesversammlung wird im Rahmen der parlamentarischen Beratung abschliessend über diese Frage befinden.
Geopolitische Lage
Angesichts der angespannten geopolitischen Lage betrachtet der Bundesrat stabile und verlässliche Beziehungen zur EU und zu den Nachbarstaaten als strategische Notwendigkeit, um Sicherheit, Unabhängigkeit und Wohlstand zu gewährleisten.
Das Paket Schweiz–EU ist dabei kein grundlegender Richtungswechsel, sondern ein gezielter Schritt zur Stärkung und Weiterentwicklung des bewährten bilateralen Wegs.
Nächste Schritte
Die Paraphierung der Abkommenstexte ist für Mai 2025 in Bern vorgesehen. Der Bundesrat wird noch vor der Sommerpause die ordentliche Vernehmlassung zum Botschaftsentwurf eröffnen. Zeitgleich werden die übersetzten Vertragstexte als Teil der Vernehmlassungsunterlagen veröffentlicht.
Die heutigen Entscheide des Bundesrates zur Struktur der Genehmigungsvorlage und zur Referendumsart fliessen direkt in die Vernehmlassungsvorlage ein und bilden anschliessend die Grundlage für die Botschaft an das Parlament.
Adresse für Rückfragen:
Kommunikation EDA Bundeshaus West 3003 Bern +41 58 460 55 55 kommunikation@eda.admin.ch